Wer seinen Ehepartner regelmäßig mit seinem E-Mail-Postfach arbeiten lässt, muss sich unter Umständen dessen Handeln zurechnen lassen – mit weitreichenden Konsequenzen. Das zeigt eine aktuelle Entscheidung des OLG Zweibrücken (Urt. v. 15.01.2025, Az. 1 U 20/24). Rechtsanwalt Rolf Becker aus Alfter zeigt auch die Konsequenzen einer Anscheinsvollmacht im Business-Alltag.
Wenn die Weitergabe von E-Mail-Zugangsdaten zur rechtlichen Falle wird
In einem Streitfall zwischen einer Versicherungsnehmerin und ihrer Versicherung wurde über den E-Mail-Account der Frau ein Abfindungsvergleich geschlossen. Später bestritt sie jedoch, dass sie die E-Mail selbst verfasst oder den Vergleich akzeptiert habe. Ihr Mann habe dies ohne ihr Wissen über ihren Account erledigt. Das OLG Zweibrücken entschied dennoch, dass sie an den Vergleich gebunden sei. Da ihr Ehemann über längere Zeit Zugang zu ihrem Postfach hatte und in ihrem Namen agierte, sei von einer Anscheinsvollmacht auszugehen.
Wann eine Anscheinsvollmacht entsteht und warum sie rechtlich bindend ist
Wer zulässt, dass eine andere Person wiederholt im eigenen Namen handelt, kann sich später nicht darauf berufen, nichts davon gewusst zu haben. Das Gericht stellte klar, dass eine Anscheinsvollmacht dann vorliegt, wenn eine Person über einen längeren Zeitraum den Anschein erweckt, eine andere sei vertretungsberechtigt. Eine ausdrückliche Zustimmung ist dann nicht mehr erforderlich – entscheidend ist allein, dass die betroffene Person es hätte erkennen und verhindern können. So wird aus liebendem Vertrauen eine Haftungsfalle.
Auch die sogenannte Duldungsvollmacht kann hier eine Rolle spielen: Wenn jemand weiß, dass ein anderer in seinem Namen Verträge abschließt, aber nicht eingreift, gilt dies als stillschweigende Genehmigung.
Relevanz für Unternehmen: Wann Geschäftsführer oder Mitarbeiter unbeabsichtigt Vollmachten erteilen
Dieses Urteil betrifft nicht nur Ehepaare, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen auf den Geschäftsalltag. Wenn ein Geschäftsführer regelmäßig seine Assistentin oder andere Mitarbeiter ohne explizite Bevollmächtigung in seinem Namen handeln lässt, kann sich daraus eine Anscheinsvollmacht ergeben. Gleiches gilt für Unternehmen, die Mitarbeitern uneingeschränkten Zugriff auf geschäftliche E-Mail-Konten gewähren. Wer solche Strukturen zulässt, kann sich später nicht darauf berufen, dass bestimmte Vereinbarungen nicht gewollt waren.
Besonders in Familienbetrieben oder kleinen Unternehmen, in denen flache Hierarchien herrschen, entstehen schnell stillschweigende Vollmachten. Auch wer es duldet, dass ein Angehöriger über längere Zeit hinweg Bestellungen tätigt oder Kundenverträge abschließt, läuft Gefahr, sich daran festhalten lassen zu müssen.
Auch im Vertrieb oder Einkauf ist die Gefahr groß. Wenn ein Mitarbeiter regelmäßig Verhandlungen führt oder Bestellungen aufgibt, ohne formell bevollmächtigt zu sein, kann dies als Anscheinsvollmacht gewertet werden. Ein Unternehmen sollte daher genau prüfen, wer nach außen hin als entscheidungsbefugt wahrgenommen wird oder mit den Konsequenzen leben.
Unterschriftensorge: i.A., i.V. oder doch der eigene Name?
Nicht nur die Nutzung eines E-Mail-Kontos kann zur ungewollten Haftung führen, sondern auch die Art der Unterschrift. Im Geschäftsverkehr gibt es verschiedene Varianten, die eine Vollmacht ausdrücken – oder im Zweifel auch über ihre Grenzen hinausgehen können.
Wer mit "i.A." (im Auftrag) unterzeichnet, gibt klar zu erkennen, dass er als Bote handelt und keine eigene Entscheidungsbefugnis hat.
Das bedeutet: Die Verantwortung bleibt beim eigentlichen Vertragspartner. Anders sieht es bei "i.V." (in Vertretung) aus – hier liegt eine Vertretungsmacht vor, etwa als Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter. Wer jedoch seinen Namen einfach ohne Zusatz unter eine Vereinbarung setzt, läuft Gefahr, persönlich zu haften, wenn keine ausreichende Vollmacht vorliegt.
In der Praxis kommt es immer wieder zu Streit, wenn Verträge von Personen unterzeichnet wurden, die nicht ausdrücklich bevollmächtigt waren. Unternehmen sollten daher genau darauf achten, wer mit welcher Befugnis unterschreibt – und ob die verwendete Unterschriftsform tatsächlich der gewünschten rechtlichen Wirkung entspricht.
Fazit: Klare Regeln und Kontrolle schützen vor unerwarteten Verpflichtungen
Das Urteil verdeutlicht, dass unbedachte Zugriffsrechte auf E-Mail-Konten und unklare Zuständigkeiten schnell zu rechtlichen Verpflichtungen führen können. Assistentinnen und Mitarbeiter, die regelmäßig Angebote versenden oder Vertragsabschlüsse vornehmen setzen ebenso den Anschein, wie Mitarbeiter, die verhandeln oder ersichtlichen Zugriff auf bestimmte Ressourcen haben.
Wer verhindern will, dass Dritte verbindliche Verträge abschließen, sollte klare Vollmachtserteilungen treffen und vor allem private sowie geschäftliche Kommunikation strikt trennen. Dazu gehören auch Regelungen, wer mit welchen Zusätzen unterschreibt. Sonst droht die unbeabsichtigte rechtsgeschäftliche Bindung – sei es in der Ehe oder im Geschäftsleben.
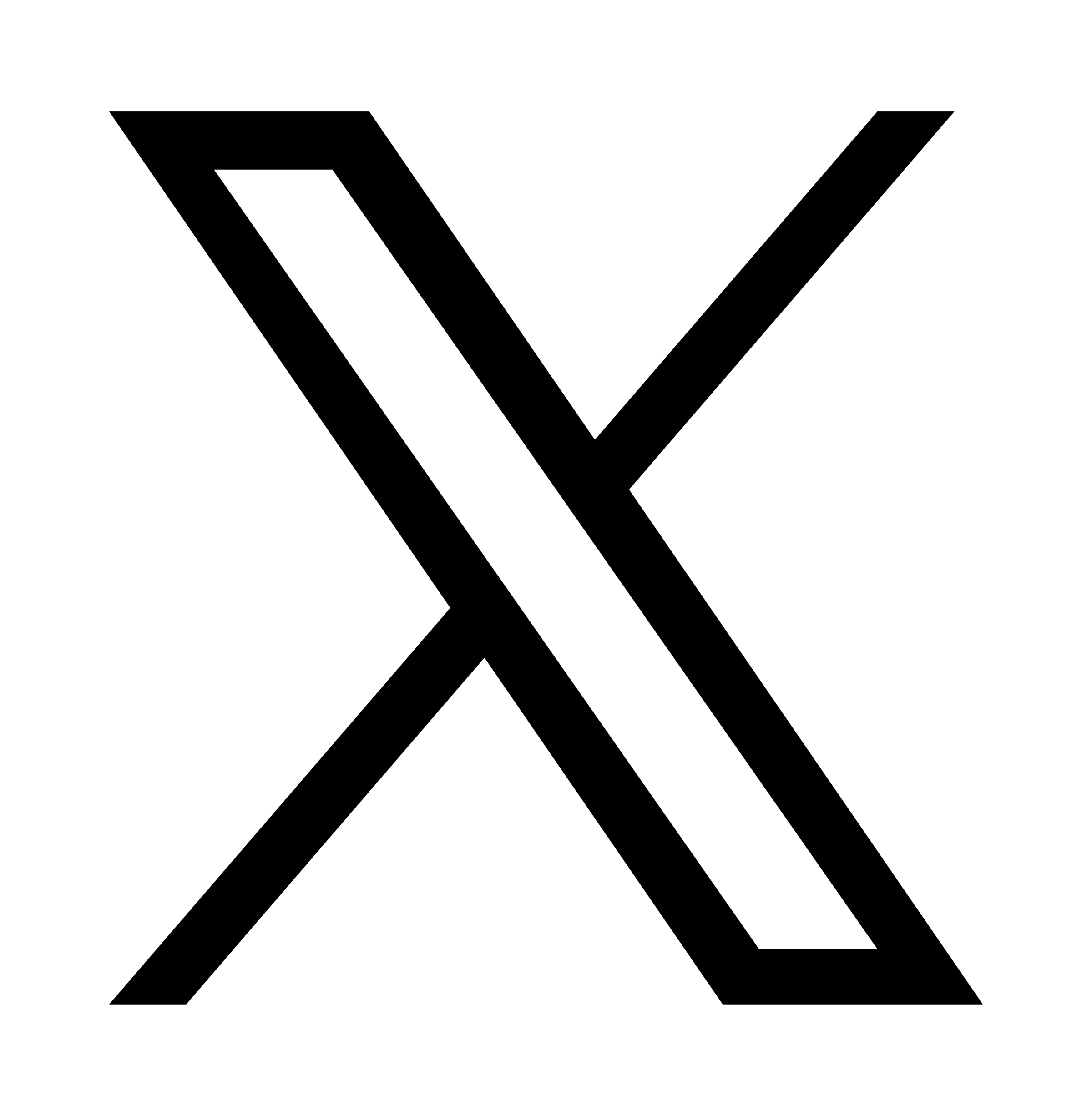 X
X
