KI-Anwendungen in der Buchhaltung: Experten-Interview mit Stefan Werner
05.03.2025 — Online-Redaktion Verlag Dashöfer. Quelle: Verlag Dashöfer GmbH.
Dipl.-Finw. (FH) Stefan Werner ist EDV-Fachprüfer in der Steuerverwaltung des Landes Brandenburg und Dozent in der Finanzverwaltung und an der Bundesfinanzakademie. Aus der Sicht eines KI-Experten in der Finanzverwaltung spricht er mit uns über seine „Lieblings-KI-Tools“ und welche Risiken jetzt auf die Buchhaltung zukommen.
Welche KI-Anwendungen gibt es bereits in der Buchhaltung?
Stefan Werner: Wenn wir über generative KI sprechen, denken viele zuerst an Chatbots – allen voran ChatGPT. Es kombiniert Textgenerierung und Datenanalyse. Speziell in der Buchhaltung geht es vor allem um Zahlen und Dokumente und da gibt es mittlerweile viele weitere hilfreiche Tools, die KI bereits integriert haben. Diese können Belege automatisch erfassen, Rechnungen erkennen und Buchungsvorschläge erstellen. Sie unterscheiden beispielsweise zwischen Reisekostenabrechnungen und Bewirtungsbelegen. Manche enthalten sogar steuerrechtliche Kataloge, um rechtliche Fragen zu beantworten.
ChatGPT hingegen greift auf ein globales Wissen zurück, das zu 95 % nicht aus Deutschland stammt. Das bedeutet, dass seine Antworten oft nicht mit dem deutschen Rechtssystem übereinstimmen. Deshalb setzen viele Unternehmen auf spezialisierte Rechtskataloge mit eigenen Chatbots. Diese greifen nicht auf allgemeine Wissensdatenbanken zu, sondern auf Vektordatenbanken, die gezielt relevante Rechtsdokumente durchsuchen.
Damit kommen Sie schon etwas auf die Risiken von generativer KI zu sprechen: Was muss man beim Umgang mit KI in der Buchhaltung beachten?
Stefan Werner: Öffentliche Chatbots wie ChatGPT senden Daten an amerikanische Server – ein absolutes No-Go in der Buchhaltung! Buchhalterinnen und Buchhalter brauchen daher eine sichere Umgebung. Zum Glück gibt es mittlerweile Lösungen auf dem Markt, zum Beispiel von Microsoft oder anderen Anbietern, die eine rechtssichere Speicherung zum Beispiel auf europäischen Servern garantieren.
Ein weiteres Risiko: Generative KI lernt aus jeder Eingabe. Ohne geeignete Schutzmechanismen könnten sensible Vertragsformulierungen aus internen Verhandlungen plötzlich anderen Nutzenden als Vorschlag angezeigt werden. Deshalb ist es entscheidend, Datenschutzvorgaben strikt einzuhalten. Hier spielt der Datenschutzbeauftragte eine zentrale Rolle: Er prüft, ob ein KI-Tool DSGVO-konform ist und sorgt dafür, dass Mitarbeitende – insbesondere in der Buchhaltung – den richtigen Umgang mit KI lernen. Auch die Frage, wo hochgeladene Dateien tatsächlich landen, ist essenziell. Genau das thematisieren wir zum Beispiel in unserem Seminar: Wir zeigen, welche KI-Anwendungen sinnvoll sind und sensibilisieren gleichzeitig für den sicheren Einsatz. Am Ende wissen die Teilnehmenden genau, wie sie KI verantwortungsvoll in ihre Arbeit integrieren können.
Haben Sie „Lieblings-KI-Tools“, mit denen Sie arbeiten?
Stefan Werner: Ich habe drei Lieblingstools, die ich regelmäßig und gerne nutze.
- ChatGPT: Trotz der angesprochenen Risiken und Datenschutzbedenken ist ChatGPT ein unglaublich hilfreiches Tool – insbesondere für die schnelle Analyse großer Datenmengen, die Texterstellung oder das Formulieren komplexer Sachverhalte. Es spart enorm viel Zeit und kann als wertvolle Unterstützung im Arbeitsalltag dienen.
- Tools zum Transkribieren: Es gibt eine ganze Reihe an guten Tools und oftmals findet man Auswertungen und Rankings, welche am besten funktionieren. Einen Überblick finden Sie zum Beispiel hier. Solche Tools sind vor allem im Berichtswesen unglaublich hilfreich, um Berichte zu schreiben, Notizen mündlich aufzunehmen oder Transkripte zu erstellen. Diese Tools sind inzwischen so gut, dass man während des Aufnehmens Korrekturen vornehmen kann und die KI das entsprechend im Transkript umsetzt.
- Napkin.ai: Hierbei handelt es sich um ein Visualisierungstool, das Texte in übersichtliche Schaubilder umwandelt. Besonders im Controlling, wo es darauf ankommt, Geschäftsergebnisse verständlich darzustellen, lassen sich mit diesem Tool klare Grafiken und Diagramme erstellen.
Wichtig ist, KI-Tools immer datenschutzkonform zu nutzen. Falls Sie sich unsicher sind, welches Tool für Sie das richtige ist, gibt es eine einfache Lösung: Viele Anbieter ermöglichen inzwischen eine monatliche Buchung. So können Sie testen, ob sich ein Abo langfristig lohnt.
Was würden Sie Unternehmen raten, die jetzt erst mit KI starten?
Stefan Werner: Unternehmen sollten nicht von Anfang an nach der perfekten KI-Lösung suchen, sondern klein starten und ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, KI spielerisch kennenzulernen. Ein guter Einstieg wären Schulungen oder Workshops, in denen die Teilnehmenden lernen, welche KI-Tools es gibt und wie sie diese sinnvoll einsetzen können. So lernen sie aktiv den Umgang mit KI, werden schrittweise sicherer und entdecken neue Anwendungsbereiche. Wichtig ist, dabei zu verstehen, dass KI nicht die Buchhaltung übernimmt, sondern in vielen Bereichen unterstützt und Prozesse optimiert.
Mein Ansatz wäre daher: Zuerst die Mitarbeitenden mitnehmen und ihnen zeigen, welchen persönlichen Nutzen KI ihnen bringt. Sobald sie den Mehrwert für sich erkannt haben, entsteht der Unternehmensnutzen automatisch – denn mit steigender Akzeptanz wird KI produktiver genutzt und das Arbeiten wird effizienter.
Viele fragen sich, wohin die Reise mit KI geht und was das für die Arbeitswelt bedeutet. Können Sie vielleicht ein paar der Ängste nehmen?
Stefan Werner: Unsere Arbeitswelt wird sich in den kommenden Jahren grundlegend verändern – und einige Aufgaben werden überflüssig. Gleichzeitig entstehen jedoch völlig neue Tätigkeitsfelder, weil Menschen mit KI plötzlich Dinge tun können, die ihnen vorher nicht möglich waren. Ein gutes Beispiel ist die Hilfe bei der Arbeit mit Excel oder sogar das Programmieren: Dank KI können wir heute programmieren, ohne es jemals gelernt zu haben. Das erweitert nicht nur unser Aufgabenspektrum, sondern macht uns auch produktiver. Wiederholende Tätigkeiten, die früher viel Zeit gekostet haben, fallen weg – und stattdessen eröffnen sich neue Ideen und Ansätze.
Ich sehe darin einen enormen Vorteil: KI nimmt uns nicht die Arbeit weg, sondern gibt uns neue Werkzeuge an die Hand, mit denen wir effizienter und kreativer arbeiten können.
Was für ein schönes und positives Schlusswort! Vielen Dank fürs Interview!
Das Interview führte die Online-Redakteurin Michelle Bittroff vom Verlag Dashöfer.
Bild: Pixabay (Pexels, Pexels Lizenz)

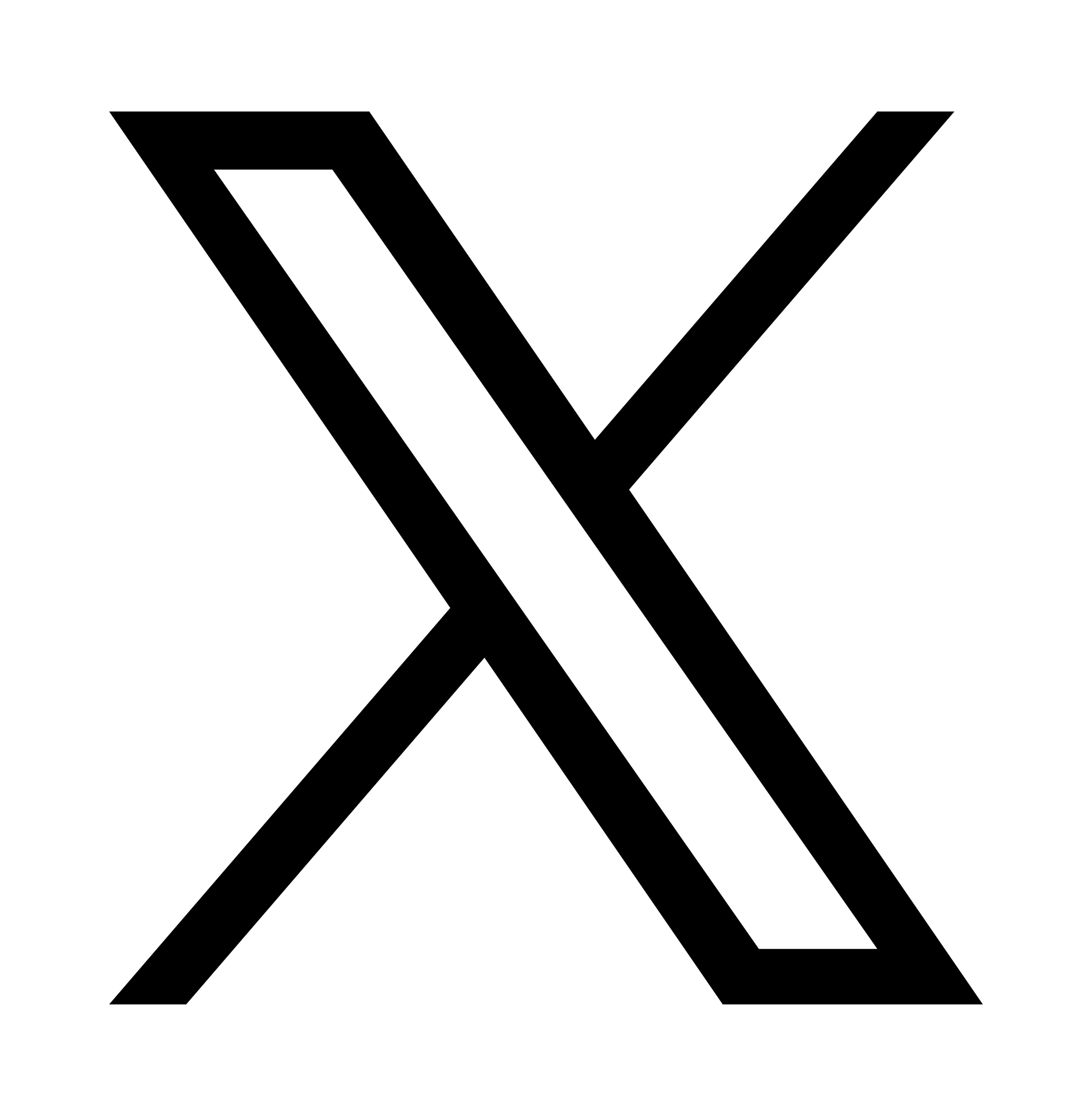 X
X
